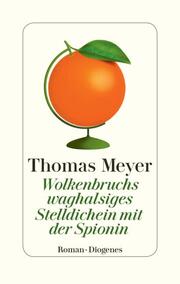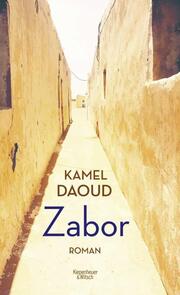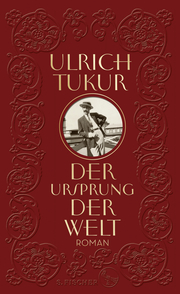Ulrich Tukur: Der Ursprung der Welt
Man muss beim Lesen des neuen Romans von Ulrich Tukur beinahe zwangsläufig an seine Rolle als Felix Murot denken, diesen leicht entrückten und fast ein bisschen aus der Zeit gefallenen Kommissar. Das absurd anmutende Selbstgespräch, das Murot in den frühen Folgen mit seinem Tumor führt, könnte zweifelsfrei auch in „Der Ursprung der Welt“ auftauchen ohne die Leser*innen allzu sehr zu überraschen. Aber an dieser Stelle genug vom Tatort.
Nach dem Tod seines Vaters befindet sich unser Protagonist Paul Goullet auf einer Paris-Reise, während der er auf einem Flohmarkt ein altes Fotoalbum ersteht, in dessen aufgedruckten Initialen er seinen Namen zu erkennen und in dessen Fotos er sich selbst zu sehen glaubt.
Auf der Suche nach Antworten begibt er sich nach Südfrankreich, doch je näher er seinem Ziel kommt, desto häufiger suchen ihn Versatzstücke seiner tatsächlichen und einer scheinbar imaginierten Vergangenheit heim.
Kongenial montiert Tukur diese (Schein-)Erinnerungen mit verstörenden Träumen und abgründig rauschhaften Bildern, die Paul Goullet auf der Suche nach der Geschichte seiner Familie und sich selbst verfolgen.
Immer wieder blendet er geradezu beiläufig die verschiedenen Zeitebenen ineinander und schafft es doch trotz allem Verwirrspiel ein kohärentes Ganzes zu schaffen.
Obwohl dieser Roman in der nahen Zukunft spielt, mutet er doch klassisch an (nicht zuletzt, weil sich unser Protagonist nach allen Möglichkeiten den modernen Kommunikationsformen verweigert) und zeigt uns im Wechselspiel, was bald sein könnte und was in den letzten knapp 100 Jahren europäischer, und vor allem auch deutscher Geschichte schon gewesen ist.
Und um an dieser Stelle nicht zu viel zu verraten, wünsche ich nun viel Spaß bei der Lektüre. Chapeau!