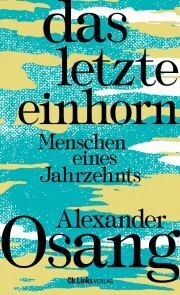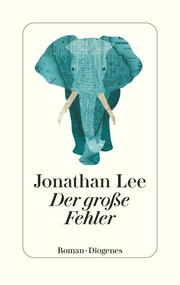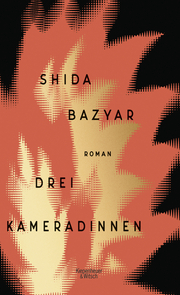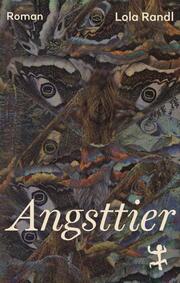Menschen wie Erdrutsche
In Claudia Durastantis Roman "Die Fremde" durchwandern wir mit der Protagonistin die kargen Hügel der süditalienischen "Basilicata", baden in einer sumpfigen Bucht auf Coney
Island, fahren in einem Zug von Kalkutta nach Delhi und hören die unendliche Stille der Wüste in einem schalltoten Raum im Guggenheim Museum in New York. Wir treffen Menschen, die "wie Erdrutsche" sind, wie "tiefschwarze Galaxien", unberechenbar, gewaltig und nebelhaft. Es ist schwierig, sich zwischen den Seiten nicht zu verlieren. "Die Fremde" zu lesen, bedeutet auch, das Buch ab und an zur Seite zu legen und sich auf die vielen drängenden Fragen einzulassen: Wo sind die Grenzen zwischen Realität und Fiktion? Kann "fremd-sein" auch "frei-sein" bedeuten? Gehören Menschen einander, wann ist etwas noch Liebe und wann schon Gewalt?
Claudia Durastanti zeigt mit "Die Fremde", dass widersprüchlich Scheinendes nicht immer widersprüchlich ist und dass zwei Versionen derselben Geschichte wahr sein können, wenn sie im Kern dasselbe erzählen. Zum Beispiel, dass zwei Menschen sich gegenseitig das Leben gerettet haben.
Weitere Tipps
- 1
- 2
- 3
- 4
- nächste
- letzte Seite